 |
 
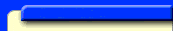
|
 |
 |
| |
Kommentar der NZZ vom 27. April 2002 |
|
Sharon hat keinen Friedensplan
Nach der erfolglosen Nahostmission seines
Aussenministers Powell, dem es nicht gelungen ist, Israel
und die palästinensische Führung zu einem förmlichen
Waffenstillstand zu bewegen, hat Präsident Bush den
israelischen Regierungschef Sharon dennoch optimistisch
als einen «Mann des Friedens» bezeichnet. Sharons vor
einem Monat begonnene militärische Offensive gegen
palästinensische Städte und Flüchtlingslager in den
autonomen Gebieten ist zwar noch kein grundsätzlicher
Beweis für fehlenden Kompromiss- und Friedenswillen.
Jede Regierung würde sich gegen derart teuflische
Attentate, wie sie in den letzten Monaten wellenweise die
israelische Zivilbevölkerung terrorisierten, mit militärischen
Mitteln zur Wehr setzen.
Allerdings muss sich gerade eine demokratisch gewählte
Regierung bei solchen Aktionen immer nach der
Verhältnismässigkeit der Mittel fragen lassen. Dass in
Cisjordanien nicht nur umkämpfte Gebäude wie im
Flüchtlingslager von Jenin, sondern zusätzlich die
Büroeinrichtungen und Archive etwa des palästinensischen
Erziehungsministeriums oder des Grundbuchamtes in
Ramallah verwüstet und zerstört worden sind, lässt sich
auch nach Ansicht kritischer israelischer Kommentatoren
nicht mehr einfach mit Terrorbekämpfung rechtfertigen. Da
ging es offenbar auch um Absichten einer längerfristigen
Herrschaftssicherung.
Sharon selber hat den alten Verdacht, dass er in
Wirklichkeit nicht an einer umfassenden
Kompromisslösung mit den Palästinensern interessiert sei,
sondern bestenfalls an einer Zementierung des bei
seinem Amtsantritt bestehenden Status quo, in dieser
Woche mit allem Nachdruck bestätigt. Auf die Anregung
eines Ministers von der Arbeitspartei, im Kabinett über
eine eventuelle Evakuierung isolierter israelischer
Siedlungen in den besetzten Gebieten zu diskutieren,
reagierte Sharon mit einem vehementen Nein. Vor den im
November 2003 fälligen Neuwahlen sei er nicht bereit, über
die Räumung irgendeiner israelischen Siedlung überhaupt
zu reden. Kurz darauf bekräftigte der Regierungschef vor
dem Auswärtigen Ausschuss der Knesset noch einmal
diesen kompromisslosen Standpunkt: Für ihn gebe es
zwischen der vorgeschobenen Siedlung Netzarim im
besetzen Gazastreifen und Tel Aviv keinen Unterschied.
Wahrscheinlich haben diese Stellungnahmen deshalb
keine hohen Wellen geschlagen, weil sie eigentlich kaum
überraschen. Der frühere amerikanische Präsident Jimmy
Carter hat dieser Tage in einem Beitrag für die «New York
Times» daran erinnert, dass Sharon stets jede
Vereinbarung, die mit einem israelischen Rückzug aus
besetzten arabischen Gebieten verbunden war, abgelehnt
habe - vom Friedensvertrag mit Ägypten (den Carter vor
bald 25 Jahren vermittelt hatte) über die Oslo-Abkommen
bis zur Friedensregelung mit Jordanien.
Wenn Sharon nun für die nähere Zukunft jeden Gedanken
an eine mögliche Räumung israelischer Siedlungen in den
besetzten Gebieten Cisjordaniens und des Gazastreifens
kategorisch zurückweist, dann entlarvt er damit allerdings
auch seine Beteuerungen, seine Regierung sei im Prinzip
zu «schmerzhaften Konzessionen» an die Palästinenser
bereit, als leeres Wortgeklingel. Ohne Verzicht Israels
zumindest auf die verstreut vorgeschobenen Siedlungen,
die teilweise durch separate Strassen miteinander
verbunden sind, wird es keinen palästinensischen Staat
mit zusammenhängenden Gebieten geben. Damit bleiben
auch Sharons frühere Äusserungen, er könne sich
längerfristig die Schaffung eines palästinensischen Staates
vorstellen, ohne glaubwürdige Substanz. Ein eigener
palästinensischer Staat, der diesen Namen verdient, kann
nur entstehen, wenn Israel sich aus dem Gazastreifen und
aus Cisjordanien auf völkerrechtlich anerkannte Grenzen
zurückzieht.
Sharon hat mit diesen dezidierten Markierungen zur
Siedlungsfrage allfällig verbliebene Hoffnungen, dass er
nach seinem brachialen Anti-Terror-Krieg doch noch Hand
für eine politische Lösung des Territorialstreits mit den
Palästinensern bieten könnte, zerstört. Seine jüngsten
Beteuerungen an ein amerikanisches Publikum, er
betrachte den saudischen Friedensvorschlag als ein
wichtiges und konstruktives Signal, sind blosse
Augenwischerei. Denn die saudische Offerte beruht ja
gerade auf der Grundidee, dass Israel sich auf die
Grenzen von 1967 zurückzuziehen hätte und im Gegenzug
alle arabischen Länder normale Beziehungen mit dem
jüdischen Staat aufnehmen würden.
Sharon und seine ideologische Gefolgschaft mögen sich
der Überzeugung hingeben, dass mit der militärischen
Zerschlagung gewalttätiger Gruppen und ziviler
Infrastrukturen in den besetzten Gebieten die
Herausforderung des palästinensischen Terrors für
geraume Zeit entschärft worden sei. Tatsächlich ist in den
letzten Wochen die Zahl der Anschläge zurückgegangen.
Doch der inzwischen 74-jährige israelische Regierungschef
hat sich bisher nicht durch politischen Weitblick
ausgezeichnet. In einigen Monaten dürfte es für Sharon
um einiges schwieriger sein als heute, in der israelischen
Öffentlichkeit zu vernebeln, dass er über kein politisches
Rezept für eine langfristig tragfähige Lösung der
palästinensischen Frage verfügt.
Viele Israeli wissen oder ahnen wohl schon lange, dass ihr
Land in den besetzten Gebieten nicht unbegrenzt als eine
Art Kolonialmacht über drei Millionen Palästinenser
herrschen kann, die man aus Gründen der nationalen
Identität ja auch nicht als israelische Staatsbürger
integrieren will. Dass der «Bulldozer» Sharon vor über
einem Jahr überhaupt von einer klaren Mehrheit gewählt
wurde, ist vor allem das zweifelhafte Verdienst der
palästinensischen Extremisten und des Vorsitzenden der
Autonomiebehörden, Arafat. Der Versuch, mit blutiger
Gewalt gegen Zivilisten einerseits und mit einem
Doppelspiel der politischen Führung andererseits die
nationalen Ambitionen voranzubringen, hat zudem die
leidgeprüfte palästinensische Bevölkerung noch tiefer ins
Desaster geführt. Nötig gewesen wären fortgesetzte zähe
Verhandlungen, Vertrauensbildung und durchdachte
Forderungen.
Aber ein militärischer Erfolg gegen den Terror allein wird
Israel keinen Frieden mit seinen arabischen Nachbarn
bescheren. Die drei Millionen arabischen Einwohner im
Westjordanland und im Gazastreifen werden sich nicht aus
ihrer Heimat hinausdrängen lassen, wie das einige
Extremisten am rechten Flügel von Sharons Koalition
unverblümt anstreben. Und die postkoloniale
Weltöffentlichkeit wird Israels willkürliche und
völkerrechtswidrige Siedlungsexpansion je länger, je
weniger akzeptieren.
Im tragisch verwickelten israelisch-palästinensischen
Konflikt ist Israel in vieler Hinsicht die stärkere Partei. Eine
überlegene Macht aber trägt auch die grössere moralische
Verantwortung für das Zustandekommen einer fairen
Friedenslösung. Sharon fehlt offenkundig das politische
Format zu einer Zielsetzung, die über einen blossen
Diktatfrieden hinausreichen würde. Manches könnte in der
verhärteten innenpolitischen Stimmung in Israel wieder in
Fluss kommen, wenn die traditionsreiche Arbeitspartei sich
dazu durchringen würde, Sharons perspektivlose Politik
nicht länger als Koalitionspartner zu stützen. Vielleicht
würde man dann auch in Washington deutlicher erkennen,
dass Sharon nicht wirklich ein «Mann des Friedens» ist.
R. M.
Neue Zürcher Zeitung, Leitartikel, 27. April 2002, Seite 1
Copyright © Neue Zürcher Zeitung AG
|