 |
 
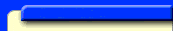
|
 |
 |
| |
Artikel SDZ 12. Februar 2002 |
|
Es war im September (1982)
Ein überlebender Palästinenser erinnert sich an das Massaker von Sabra, für das Ariel Scharon womöglich angeklagt wird
Von Florian Harms
Er muss immer etwas in den Händen haben. Schlüssel, Handy, Kugelschreiber. Er sitzt an einem der Tische seines Lokals, und die Finger seiner Hände greifen wie von
selbst nach einem Bierdeckel, betasten ihn, drehen ihn, schnippen ihn schließlich weg, nur um sich einen neuen zu greifen.
Die Erfahrung des Grauens, das er mit den Augen eines Fünfjährigen sah, ließe sich vollständig hinter den sorgfältig gegelten Haaren, dem eleganten Kinnbärtchen, der
schwarzen Kellnerhose und dem schicken Hemd verbergen, wären da nicht diese rebellischen Hände, die durch ständige Bewegung verraten, dass da etwas ist. Akram
El-Khatib muss seinen Händen immer etwas zu tun geben. Zum Beispiel jetzt den Teebeutel aus seinem Glas fischen und dessen Schnürchen um einen Löffel wickeln.
Alles andere an ihm wirkt souverän: sein Gang, sein Blick, sein Humor, von dem man unvermittelt getroffen wird, wenn man seine Pizzeria zum ersten Mal betritt, nach
Herrn El-Khatib fragt und zur Antwort bekommt, der Chef müsse gerade schwer in der Küche schuften. Schließlich sei Mittagessenszeit. Dabei ist er es doch selbst,
der Chef. Akram El-Khatib ist stolz auf das, was er mit seinen 24 Jahren erreicht hat. Als er vor vier Jahren nach Berlin kam, hatte er wenig außer einer festen
Vorstellung von dem, was er wollte. Die Lehre in einer Autowerkstatt in Nordrhein-Westfalen war am Meister gescheitert. „Ein Chaot. Ein Nazi. Kein Ausländer hat es
bei dem ausgehalten“, sagt er.
Sie schossen wahllos
Also Berlin, wo der Onkel eine Aushilfe in seinem Restaurant gut gebrauchen konnte. Dann ein Imbiss-Wagen am Ostbahnhof. Der lief so gut, dass El-Khatib ihn vor
einem halben Jahr gegen ein eigenes Lokal in Schöneberg tauschen konnte: „So wie ich es immer haben wollte. Italienische, griechische und mexikanische
Spezialitäten.“ Keine arabischen? – „Nein, arabische nicht.“ Warum der in Jülich bei Aachen geborene Akram El-Khatib, Kind palästinensischer Eltern, keine
arabischen Spezialitäten verkauft und warum seine Hände ständig auf Wanderschaft sind, mag verstehen, wer sich etwas Zeit nimmt und ihm zuhört. Zeit ist da, auch
heute ist wieder niemand zum Essen in sein Lokal gekommen. „Am Anfang lief es gut“, sagt El-Khatib, „aber dann kam die Katastrophe in den USA. Die Leute denken
sich: Döner-Läden gehören Türken, also kein Problem. Eine Pizzeria aber kann nur einem Italiener oder einem Araber gehören. Da bekommen sie Angst.“
El-Khatibs ganz persönliche Katastrophe liegt viele September weiter zurück als der des vergangenen Jahres. Erst fünf Jahre alt war er im September 1982 und erinnert
sich doch an viele Einzelheiten. Sehr viele Einzelheiten. Das Haus im palästinensischen Flüchtlingslager Sabra, West-Beirut, hatten seine Eltern gerade erst bezogen.
„Sie hatten sich wohlgefühlt als Gastarbeiter in Westdeutschland“, erzählt El-Khatib, „aber dann hieß es: Ihr müsst ausreisen und mindestens drei Monate wegbleiben.
Danach könnt ihr wieder rein.“ Die Zeit war ungünstig für eine Rückkehr in den Libanon, in dem seit 1975 ein mörderischer Bürgerkrieg tobte. Im Juni 1982 marschierte
die israelische Armee in den Libanon ein, um die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) und Jassir Arafat von dort zu vertreiben. Es war ein schmutziger
Einsatz, wie man im Militär-Jargon sagt. Was die israelische Armeeführung nicht selber machen wollte, überließ sie ihren libanesischen Schergen von den christlichen
Milizen – den „Forces Libanaises“.
Sie kamen durch den Hintereingang des Hauses, daran erinnert sich El- Khatib genau. Schossen wahllos auf alles und jeden. Der Onkel stürmte zum Vorderausgang
hinaus. Er selbst ging an der Hand seiner Mutter, stolperte. Seine kleine Hand entglitt ihr. Er fiel über die Türschwelle, das Gesicht auf dem Boden. Die hinter ihm
Rennenden traten auf seinen Rücken. Alles wurde schwarz. Seine Großmutter hetzte zurück, zerrte ihn an der Hand hoch und flüchtete mit ihm in ein anderes Viertel,
zum Versteck in einer Moschee. Doch auch dorthin kamen sie, schossen wieder. Also rannte der Junge weiter an der Seite der Mutter, die seine vier Monate alte
Schwester in den Armen hielt. „Überall in den Straßen lagen Leichen. Viele ohne Köpfe, ohne Arme. Unter dem Auto meines Vaters lagen mehrere Leichen. Ich
denke oft daran.“ El-Khatib erzählt ruhig, so als sei das, was er vor neunzehn Jahren sah, längst abgehakt. Aber es ist nicht vorbei.
Es war ein Gemetzel, ein Massaker. Ausgeführt von christlich- libanesischen Milizen in den palästinensischen Lagern Sabra und Schatila – aber offen geduldet von der
israelischen Armee. Von 3000 Ermordeten spricht die PLO, die meisten anderen Quellen nennen 800 bis 1500 Opfer. Nach Augenzeugenberichten sollen die
israelischen Soldaten die Lager in der Nacht vom 16. auf den 17. September 1982 nicht nur abgeriegelt, sondern auch mit Leuchtraketen erhellt haben, damit ihre
Verbündeten besser sahen, wohin sie schießen mussten. Initiator und Oberbefehlshaber der israelischen Libanon- Invasion war der heutige israelische Ministerpräsident
Ariel Scharon, damals Verteidigungsminister. Ein israelischer Untersuchungsausschuss wies Scharon 1983 indirekte Schuld an dem Massaker zu und zwang ihn zum
Rücktritt.
23 Angehörige der Opfer wollen nicht hinnehmen, dass Scharon als Mitverantwortlicher des Verbrechens so glimpflich davongekommen ist. Vertreten durch einen
libanesischen und zwei belgische Menschenrechts-Anwälte, haben sie vor einem Gericht in Brüssel Klage gegen Scharon eingereicht. Der ungewöhnliche Ort erklärt
sich aus einem seit 1993 geltenden belgischen Gesetz, das Gerichtsverhandlungen über Verstöße gegen die Genfer Kriegsrechtskonvention ermöglicht – egal, von wem
und wo auf der Welt sie begangen wurden. Diese einzigartige Regelung hat dazu geführt, dass sich die Liste der möglicherweise bald in Belgien Angeklagten inzwischen
wie ein Who’s who der Weltpolitik liest: Saddam Hussein, Fidel Castro, Jassir Arafat. Doch der Fall Scharon ist bisher der einzige, dessen Zulassung vor Gericht
verhandelt wird.
Flucht vor den Mörderbanden
Ende Januar stellten Scharons Verteidiger ihre Argumente vor, die sich hauptsächlich gegen die Zuständigkeit der belgischen Justiz richteten. Zudem sei ihr Mandant
bereits durch den israelischen Untersuchungsausschuss 1983 „gerichtet“ worden, was eine erneute Verhandlung auch nach belgischem Recht ausschließe. Kurz nach
dem Auftritt von Scharons Verteidigern wurde ein möglicher Kronzeuge in dem Verfahren, der frühere libanesische Milizenführer Elie Hobeika, bei einem
Bombenanschlag in Beirut getötet.
Das Gericht wird vermutlich Anfang März darüber entscheiden, ob es die Klage gegen Ariel Scharon zulassen wird, erst dann könnte der israelische Ministerpräsident
formal wegen der Massaker angeklagt werden.
Akram El-Khatib gehört nicht zu den Klägern in Brüssel, er verfolgt den Fall aus der Ferne. Vielleicht ist es weniger seine echte Überzeugung als etwas, das er sich
zum Schutz seines Selbstwertgefühls einredet, wenn er sagt: „Scharon ist nicht stark, er ist feige.“ Vielleicht ist es aber auch die Wahrheit. Jedenfalls ruhen El-Khatibs
Hände bei diesem Satz für einen kurzen Moment. Nur bei diesem Satz.
Nach der Flucht vor den Mörderbanden versteckten sich seine Eltern an verschiedenen Orten im Libanon. Als zwei Jahre später die ersten Flüge wiederaufgenommen
wurden, kauften sie mit ihrem letzten Geld Tickets und kamen zurück nach Deutschland. Diesmal nicht als „Gastarbeiter“, sondern als Flüchtlinge. Zweimal war
El-Khatib seitdem wieder im Libanon, wo seit 1990 offiziell Frieden herrscht – trotz gelegentlicher israelischer Luftangriffe, syrischer Besatzungstruppen und dem
Terrorkrieg der Hisbollah gegen Nordisrael. „Ich könnte dort nie wieder leben,“ sagt er, „wegen der Armut, die sich nicht verändert hat. Und wegen der Erinnerungen.“
Vor drei Monaten ist seine Tochter geboren. Er und seine Frau haben sie Dunja genannt, was auf Arabisch „Welt“ bedeutet. Vielleicht verbinden sie ja damit die
Hoffnung auf eine bessere Welt als jene, die El-Khatib kennt. Wenn man zu ihm sagt: „Du hast ein bewegtes Leben“, dann antwortet er: „Ein anstrengendes Leben.“
Und seine Hände greifen zu dem herumstehenden Salzstreuer. Ihnen soll nie wieder etwas entgleiten – auch keine rettende Hand wie damals in Sabra.
Mindestens 800 Menschen wurden 1982 beim Überfall christlicher Milizen auf die Palästinenser-Lager Sabra und Schatila umgebracht.
Copyright © Süddeutsche Zeitung
|