 |
  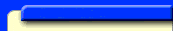
|
 |
 |
| |
Artikel der NZZ vom 11.
März 2003
|
|
|
Verlorener Krieg - für alle Seiten?
Fakhri Saleh
Arabische Intellektuelle beziehen Stellung zur Irak-Krise
Der geplante Angriff auf den Irak löst in vielen arabischen Ländern
Zorn und Unmut aus. Auch die Intellektuellen stellen sich gegen eine
amerikanische Intervention, üben aber zumindest teilweise auch Kritik
an den eigenen Institutionen. Fakhri Saleh, Literaturkritiker und regelmäßiger
Mitarbeiter von "Al-Hayat" und anderen arabischen
Tageszeitungen, hat einige der wichtigsten Stimmen zusammengestellt.
Die arabische Welt liegt dieser Tage tief im Schatten der kolonialen
Vergangenheit. Die Artikel, in denen arabische Intellektuelle zum
drohenden Angriff der USA auf den Irak Stellung beziehen, beschwören
die Zeit vor der Unabhängigkeit, als die arabischen Länder während
mehr als eines Jahrhunderts von westlichen Mächten besetzt waren.
Dringlichster Punkt in der Diskussion, die nicht nur in Zeitungen und öffentlichen
Gesprächsrunden, sondern auch im Privaten stattfindet, ist die Befürchtung,
dass Amerikas Argumente für den Krieg nur wenig mit seinem eigentlichen
Handeln zu tun haben könnten.
Diese Frage stellen sich die arabischen Intellektuellen nicht nur im
Hinblick auf den konkreten Verlauf des Krieges und die Absichten der
US-Regierung. Ebenso treibt sie die Besorgnis über den Aufruhr um, in
den die arabische Welt nach der von Amerika geplanten vehementen Attacke
- in den ersten zwei Tagen sollen 3000 Bomben und Geschosse über dem
Irak niedergehen - und der folgenden Okkupation des Landes gestürzt
werden könnte. Darf man den Versicherungen Amerikas glauben, sein
einziges Ziel seien die Entwaffnung des Iraks und der Sturz von Saddams
Regime? Oder geht es vielmehr darum, dass mit dem Krieg der Aufstieg
einer anderen Großmacht verhindert werden soll? Oder ist Amerika vorab
am irakischen Öl interessiert?
Handlungsbedarf - aber nicht so
In einem für die in London publizierte Tageszeitung "Al-Hayat"
verfassten Text schrieb der Lyriker und Denker Adonis - eine der
profiliertesten Stimmen der arabischen Welt - , es sei "im
menschlichen wie intellektuellen Sinn eine Notwendigkeit, Saddam
Husseins Regime ein Ende zu setzen; denn dieses Regime tut nicht nur den
Menschenrechten der Iraker, sondern den Menschenrechten schlechthin
Gewalt an. Wie jede andere faschistische und diktatorische Herrschaft
ist es eine Pest, welche die ganze Menschheit bedroht. Aber die
Entmachtung Saddam Husseins dürfe nicht mit der Zerstörung und
Besetzung des Iraks und dem Zugriff auf dessen Ölreserven einhergehen.
Zudem spricht Adonis den Amerikanern in der gegenwärtigen Situation die
politische Glaubwürdigkeit ab: Die USA hätten einerseits maßgeblich
zur Stärkung Saddam Husseins und anderer undemokratischer Regime in der
Welt beigetragen, anderseits Initiativen von globaler Tragweite - dem
Kyoto-Protokoll und dem Internationalen Strafgerichtshof - ihre Zusage
verweigert; zudem verfügten sie selbst über Massenvernichtungswaffen
und tolerierten je nach eigener Interessenlage deren Besitz durch andere
Staaten.
Adonis schloss seinen Artikel mit der Überlegung, dass Demokratie und
Krieg geradezu antithetisch sind: Demokratie bedeute Dialog, Differenz
und Verhandlung, während der Krieg allein auf die Karte der Macht setze
und dabei Flexibilität und Differenz verunmögliche. Nicht dadurch,
dass man das Land mit Krieg überziehe, werde im Irak eine Demokratie
geschaffen; vielmehr müssten dort die Wurzeln einer Kultur von Gewalt,
Intoleranz und Diktatur freigelegt und zerstört werden. Ein von den
Amerikanern ins Land getragener Krieg aber, so fürchtet Adonis, wuerde
den Boden zerstören, auf dem dann Demokratie, Freiheit und der Dialog
der Kulturen gedeihen könnten. In diesem Sinn bekennt sich der Dichter
zu jener europäischen Position, die im Krieg nicht den gangbaren Weg
zum Frieden sieht.
Auch der im belgischen Exil lebende irakische Intellektuelle Kamel
Shayyaa ist der Ansicht, dass "Saddams Sturz wünschenswert ist,
doch dass dies nicht Sache der Amerikaner sein darf". Angesichts
der geopolitischen Lage und der komplexen inneren Struktur des Iraks
warnt Shayyaa davor, dass mit dem drohenden Krieg die Büchse der
Pandora geöffnet würde; er sieht eine lange Phase der Unruhen im Irak
und in den umliegenden Ländern voraus. Ähnlich argumentiert der ägyptische
Dichter und Schriftsteller Ahmad Hijazi: Er verurteilt Saddam für die Zerstörung
des Iraks und die Übergriffe auf muslimische Nachbarländer, sieht aber
in einem Angriff der USA keine Lösung. Saddam sei nicht der einzige
arabische Diktator, und die Amerikaner - die gestern wie heute solche
Regime je nach Interessenlage stützten - seien nicht dazu berufen, nun
der arabischen Welt Demokratie, Menschenrechte und Gerechtigkeit zu
bringen.
Dass in den vergangenen Wochen weltweit Millionen Menschen auf die
Strasse gingen, um gegen den drohenden Krieg zu demonstrieren, gab den
arabischen Intellektuellen Rückhalt in ihrer eigenen Kritik am Vorgehen
der USA. Der ägyptische Soziologe und Politikwissenschafter Sayyed
Yassin glaubte daraus ableiten zu können, dass "das amerikanische
Empire zumindest in moralischer Hinsicht den Krieg schon verloren hat,
bevor der erste Schritt auf diesem neuen Weg zur globalen Hegemonie überhaupt
getan ist". Der syrische Politologe Mutaa Safadi meint, die
Demonstrationen gegen den Krieg seien insbesondere in Europa von einem
"historisch nie gekannten" Ausmaß und signalisierten die
weitgehende politische Isolation Amerikas; der ägyptische Dramatiker
Alfred Faraj sieht sogar die ganze Welt in zwei Lager geteilt und hofft,
die weltweite Friedensbewegung werde als Antidot gegen das "Gift
des Krieges" wirken.
In ihren Stellungnahmen gegen den Krieg blenden die Autoren aber auch
die Kritik an Missständen in der arabischen und islamischen Welt nicht
aus. Sie akzeptieren die Vorwürfe seitens des Westens, dass nichts
unternommen werde, um der Verbreitung von Fundamentalismus und religiöser
Intoleranz Einhalt zu gebieten. Den arabischen Regimen und
Gesellschaften sei es nicht gelungen, ein Klima zu schaffen, das dem
Fortschritt und der Demokratisierung zuträglich sei; stattdessen hätten
sie sich im "Zusammenprall der Zivilisationen" in ein rein
reaktives und durch innerarabische Konflikte noch erschwertes Rückzugsgefecht
verstrickt.
Ein neues Religionsverständnis
Auf dieser Kritik fußt auch ein für die in London publizierte Zeitung
"Al-Sharq Al-Awsat" geschriebener Artikel des syrischen
Denkers Hashem Saleh. Saleh gilt als Experte in Fragen des Islam und ist
eine der prominentesten Stimmen, die heute eine eigentliche
Revolutionierung des Religionsverständnisses fordern. Sowohl die religiöse
Unterweisung als auch das Verhältnis des Islam zu Gesellschaft,
Politik, kollektivem Bewusstsein und individueller Freiheit müssen laut
Salehs Beitrag neu interpretiert werden. Doch verweist der Autor - und
richtet sich damit vorab an die Intellektuellen und die politischen Führer
des Westens - auch auf einen politischen Faktor, der für eine
Entspannung zwischen der muslimischen und der westlichen Welt
unabdingbar sei. Noch wenn eine amerikanische Intervention im Irak das
ganze geopolitische Szenario des Mittleren Ostens verändern würde, so
schreibt er, vergäßen die Araber darüber nicht das Drama der Palästinenser.
Ohne eine Lösung dieser Frage sei auch dem islamistischen
Fundamentalismus nicht beizukommen.
Nimmt man der arabischen Welt den Puls, so wird in der Tat das Gewicht
dieses Anliegens offensichtlich. Während zu fürchten steht, dass ein
amerikanischer Angriff auf den Irak der Intoleranz, dem Hass und
letztlich dem Terrorismus Vorschub leisten könnte, würden die Araber
ein gerechtes und sachliches Herangehen an die Palästinenserfrage im
Geist der bereits vorliegenden Resolutionen als wichtigen Schritt zur
Entspannung des Verhältnisses zwischen islamischer und westlicher Welt
wahrnehmen.
Neue Zürcher Zeitung, 11. März 2003, Feuilleton; Seite 57
|
|
|
Copyright © Neue Zürcher Zeitung AG
|




