 |
  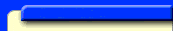
|
 |
 |
| Artikel aus NZZ vom 24. März 2003 |
Kulturgüterraub - und nun noch Bomben?
Die archäologischen Schätze des Iraks in Gefahr
Die Feuersbrunst hatte eine derartige Hitze entwickelt, dass die Lehmziegel
zu Stein gebrannt wurden. Nein, nicht während des letzten Golfkriegs,
sondern vor vielleicht zweitausend Jahren: Damals war das etwa 30 km südlich
von Babylon gelegene Borsippa durch Flammen zerstört worden. Einmal im Jahr
wurde zuvor in feierlicher Prozession die Kultstatue Nabus, des Gottes der
Schreibkunst, von Borsippa nach Babylon gebracht. Diese prachtvollste Stadt
der damals bekannten Welt wollte Alexander der Grosse nach der Eroberung zur
Hauptstadt seines Weltreiches machen. Stattdessen fand er dort den Tod.
In der Regierungszeit Saddam Husseins, der sich gern auf den Babylonierkönig
Nebukadnezar bezieht, ist Babylon rekonstruiert worden, so dass es wie die
orientalische Ausgabe eines Disneyland wirkt. "Macht nichts",
meint dazu die irakische Archäologin Selma ar-Radi, "was neu gebaut
ist, lässt sich leicht wieder beseitigen." Aber liesse sich
Authentisches wie das antike Ischtar-Tor oder das in seiner Abstraktion
geradezu modern wirkende Löwenmonument retten, falls hier Bomben fielen?
Grabungsstätten in der Gefahrenzone
Nun liegt Babylon nicht in einer so unmittelbaren Gefahrenzone wie Uruk, die
Heimat Gilgameschs. Eigentlich wäre dort jetzt die Saison für Grabungen.
Doch Margarete van Ess vom Deutschen Archäologischen Institut, die seit
Jahren in Uruk arbeitet, bleibt dieses Jahr in Berlin. Uruk liegt nur knapp
100 km von der Grenze zu Kuwait entfernt, umgeben von Radarstationen. Die
Tatsache, dass Uruk und Abrahams Geburtsort Ur in der südlichen
Flugverbotszone gelegen sind, hat ohnehin schon dazu geführt, dass im näheren
Umfeld der Grabungsstätten Treffer von Kampfflugzeugen der amerikanischen
und der britischen Luftwaffe niedergingen. Fast alle ausländischen
Grabungsteams haben vor dem Ausbruch des Krieges den Irak verlassen.
Schon nach dem Golfkrieg Anfang der neunziger Jahre waren Grabungen ausländischer
Teams auf Grund der Sanktionen zunächst überhaupt nicht mehr möglich.
Etwa zwanzig kehrten dann im Laufe der letzten Jahre wieder zurück; laut
Gerüchten waren zuletzt noch die Österreicher, die in Borsippa arbeiten,
und die Italiener im Land. Sie waren auch die Ersten, die nach dem letzten
Golfkrieg ihre Arbeit wieder aufnahmen. Auch in Hatra, der einzigen unverfälscht
erhaltenen Stadt der Parther, setzten die Archäologen ihre Tätigkeit fort,
indem sie die Grabung "Forschung" nannten. Hatra mit seinen
hellenistisch anmutenden Tempeln und Toren hat freilich unter Saddams Ägide
einen Wandel durchgemacht; so stellt Selmas Schwester, die Künstlerin Nuha
ar-Radi, in ihrem "Bagdad-Tagebuch" 1995 entsetzt fest: "Der
gesamte Eindruck ist verfälscht - Wände und Säulen sind mit seinen
(Saddam Husseins) Initialen verschandelt, überall Beton." Hatra liegt
wenige Kilometer von Mossul entfernt, auf gleicher Höhe wie Assur. Auch
Nimrud und Ninive, dessen älteste Spuren aus dem 6. Jahrtausend v. Chr.
stammen, liegen in der Region, hart an der Grenze zur nördlichen
Flugverbots- und kurdischen Schutzzone und damit womöglich in einem künftigen
Kampfgebiet. Vielleicht aber sind die archäologischen Stätten, die in
unmittelbarer Nachbarschaft von Bagdad liegen, weit mehr gefährdet. Wie die
Zikkurat (mesopotamische Stufenpyramide) von Aqqaquf, oder Sippar, wo die grösste
bisher bekannte Bibliothek von 500"000 Tontafeln entdeckt worden ist.
Oder die immer noch monumentalen Reste des Palastes des Sassanidenkönigs
Sapur in Ctesiphon, der alten Hauptstadt Seleukia, die Alexanders General
Seleukos um 290 v. Chr. am Tigris hatte anlegen lassen, um Babylon zu schwächen.
Könnte das mit einer Höhe von 30"m und einer Weite von 20"m
weltweit grösste Tonnengewölbe aus Ziegelmauerwerk, unter dem ein Mensch
verschwindend klein wirkt, nur schon den Druckwellen starker Detonationen
standhalten?
In Bagdad selbst haben die Mongolen nach ihrem verheerenden Einfall 1258
kaum ein Gebäude der glanzvollen Abbasidenzeit stehen lassen. Die Stadt,
die sich danach nie mehr zu alter Grösse erholt hatte, hütet nur wenige
archäologisch-architektonische Kleinode - ausser in dem an
unvergleichlichen Schätzen immens reichen Irak-Museum. Erst vor gut zwei
Jahren hatte es seine Pforten wieder geöffnet, nachdem es vierzehn von den
vergangenen zwanzig Jahren geschlossen gewesen war. In den achtziger Jahren
tobte der irakisch-iranische Krieg, kurz darauf entfesselte der irakische
Angriff auf Kuwait den Golfkrieg.
Die Museumsleitung hatte alle beweglichen Exponate in sichere Unterkünfte
abtransportiert. Ende 1999 waren sie fast vollzählig wieder an ihrem Platz.
Nur hochwertige Schmuckstücke warteten noch auf neue Vitrinen mit
Alarmanlagen, die es vorher nicht gegeben hatte. Nachdem der Antiquitätenschmuggel
in den Nachkriegsjahren ungemein zugenommen hatte, wollte man zumindest im
Museum die Kleinode vor Raub schützen. Der weltweit florierende Markt mit
gestohlenen Kunstschätzen hatte während des Golfkrieges begonnen. Das über
den Irak verhängte Embargo, an dem die Regierenden durch illegale Geschäfte
kräftig verdienen, begünstigt den Handel mit Antiquitäten, der mit
ziemlicher Sicherheit nur dank Rückendeckung von oberster Stelle in solch
grossem Ausmass funktionieren kann. Zwar hängt man ab und zu einen kleinen
Dealer, doch erweckt das eher den Eindruck eines Ablenkungsmanövers.
Raubbau am Kulturgut
Donny George, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Irak-Museums, möchte
darüber natürlich nicht sprechen, so viel er sonst zu erzählen weiss über
Schmuggel von Rollsiegeln und antiken Statuen. Es fehlen die Gelder, um Wärter
zu bezahlen an verlassenen Grabungsplätzen. Selbst wenn es einen vor Ort
gibt, ist er bewaffneten Räubern hilflos ausgeliefert. Nimrud und Ninive
sind in besonderem Masse von dieser neuen Plünderung betroffen. Die
assyrischen Statuen, zu gross, um intakt abtransportiert zu werden, wurden
zerschlagen, um auf dem internationalen Kunstmarkt in Teilen verkauft zu
werden. Eine Figur, halb Tier, halb Mensch, war bereits in dreizehn
Einzelteile zerlegt, als die Polizei auftauchte. Der Kopf der Statue liegt
nun in Bruchstücken zur Restaurierung im Museum - und muss warten.
Angesichts der Kriegsdrohung galt die Sorge der Museumsleiter in den
vergangenen Wochen mehr der Rettung ihrer einmaligen Kunstschätze. Mit
erstaunlicher Unaufgeregtheit äusserte sich Nawala al-Mutawalli,
Vorsteherin der archäologischen Abteilung und Expertin für die sumerische
Sprache, noch im Februar über die gefährliche Lage. Wenn es einen erneuten
Krieg geben sollte, "nehmen wir so viele Exponate wie möglich heraus
und packen sie wieder fort an geheimen Orten", sagte Frau Mutawalli. In
jedem Fall wolle man verhindern, dass es wie im letzten Krieg zugehen würde.
Da das Museum in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer Telefonzentrale liegt,
die bombardiert worden war, gingen wertvolle Stücke verloren. Ärgernis
jedoch waren die Verluste durch Diebstahl während der chaotischen Zeit des
Krieges und der Volksaufstände. Das Résumé 1991: 4000 Exponate fehlten.
Seit der Rückgabe einer babylonischen Inschriftentafel durch das British
Museum im Jahr 1995 sind es nur noch 3999.
Die meisten der monumentalen Statuen und assyrischen Wandreliefs können
nicht entfernt werden. Ähnlich wie im Nationalmuseum von Beirut in den
Jahren des Bürgerkrieges mussten sie eingemauert werden. Wie viel Schutz
das bietet gegen neueste Waffensysteme, die mit Leichtigkeit mehrere Meter
dicke Betonmauern durchschlagen können, sei dahingestellt. Nach Nawal
al-Mutawallis Worten ist Krieg das Letzte, was der Irak bei seinen Bemühungen
um Schutz historischer Güter brauchen kann. "Amerika spricht von
Zivilisation. Dann hätte es einen Krieg verhindern sollen. Alle irakischen
Antiquitäten sind einmalig und unersetzbar."
Cristina Erck
|
|
Neue Zürcher Zeitung, Ressort
Feuilleton, 24. März 2003, Nr.69, Seite 21
|
| Copyright © Neue Zürcher Zeitung AG |
|




