 |
  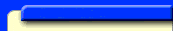
|
 |
 |
| Artikel aus NZZ vom 25. März 2003 |
Ölbrände als Kriegswaffe Saddams
Langfristige Folgen der Zerstörungen in Kuwaits Ölfeldern
Bereits in den ersten Kriegstagen ist gemeldet worden, Amerikaner hätten
Sprengstoffladungen bei den Ölquellen im Süden des Iraks entdeckt. Brennende
Ölfelder und -gräben hatte Saddam Hussein auch im ersten Golfkrieg als Waffe
eingesetzt. Die schlimmsten Schäden verursachten aber die grossen Ölseen in
Kuwaits Wüste.
bt. Die Truppen Saddam Husseins sollen seit Kriegsbeginn im Süden des Iraks
verschiedene Ölquellen in Brand gesetzt haben, und auch von mit Öl gefüllten
Kanälen, die bei Bagdad brennen sollen, wird in den Medien berichtet. In den
letzten Tagen gab es zudem Meldungen, wonach die amerikanischen Truppen in von
ihnen gesicherten Ölfeldern Vorkehrungen der Iraker gefunden hatten, die
diesen erlaubt hätten, die Quellen anzuzünden. Dies würde geheimdienstliche
Warnungen der letzten Monate bestätigen. Das eigentliche Schreckensszenario
jedoch, dass viele Hunderte von Ölquellen in Flammen stehen, scheint
zumindest bis anhin nicht Wirklichkeit geworden zu sein. Während im Süden
nach dem Vorrücken der amerikanischen und britischen Truppen vermutlich nicht
mehr mit solch einem Flammeninferno zu rechnen ist, kann aber noch nicht
ausgeschlossen werden, dass die Ölfelder im Nordosten des Landes - etwa ein
Drittel der Quellen des Iraks - im Laufe des Krieges angezündet werden.
Bagdads Taktik der verbrannten Erde
Dass Terror mit brennenden Ölquellen zum Kriegsarsenal Saddams gehört, hatte
dieser bereits im ersten Golfkrieg bewiesen. Schon im Dezember 1990, im
Vorfeld der militärischen Konfrontation mit den Streitkräften der
Alliierten, hatten seine Soldaten Sprengladungen an gewissen Quellen im von
ihnen besetzten Kuwait placiert und die Wirkung der Detonationen geprüft. Mit
Beginn der Luftschläge am 16. Januar 1991 begann dann die eigentliche Zerstörung,
und Ende Februar brannten mehr als 600 Ölquellen, bei anderen floss das Öl
ungehindert in die Umgebung und bildete eigentliche Seen in der Wüste - weit
über 200 an der Zahl (die Angaben variieren) mit einer Fläche von insgesamt
etwa 50 Quadratkilometern.
Über drei Viertel der etwa 1000 Ölquellen Kuwaits wurden von den Irakern auf
diese Weise zerstört. Zudem pumpten diese etwa 10 Millionen Barrel Öl
absichtlich in den Golf, ein Vielfaches der Menge, die bei der Havarie der
"Exxon Valdez" ins Meer gelangt war. Es bildete sich ein viele
Tausende Quadratkilometer grosser Ölteppich. Laut Angaben der US Air Force
gerieten zusätzlich aber auch Quellen durch Bomben der Alliierten in Brand,
und auch Öl-Verteilstationen wurden so zerstört.
Nachdem die Kämpfe Ende Februar beendet worden waren, reisten sofort die
ersten Spezialisten zur Löschung von Ölbränden nach Kuwait, unter ihnen der
legendäre Texaner Paul N. "Red" Adair. Feuer in allen
Himmelsrichtungen, dichter Rauch in einer Landschaft ohne erkennbare
Silhouetten machten die Orientierung schwer. Zudem gab es überall Minen. Die
Hauptprobleme jedoch bestanden darin, dass sowohl Wasser als auch die
notwendigen Maschinen zum Löschen der Feuer - Krane, Bagger, Bulldozer für
den Strassenbau und Spezialausrüstung - fehlten. Alles musste hergebracht
oder am Ort bereitgestellt werden. So beschreibt Adair, der inzwischen bald
88-jährige Pionier unter den Feuerlöschern, auf seiner Homepage die
Situation damals in Kuwait. Selber werde er diesmal aber nicht mehr in den
Irak reisen, gab er einem Journalisten kürzlich zu Protokoll.
Insgesamt gibt es weltweit nur wenige Firmen, die eine solche Aufgabe bewältigen
können, und das Löschen und Neufassen einer Quelle kann Tage bis Wochen
dauern. Gefährlich dabei ist laut den Spezialisten weniger das brennende Öl
- zum Teil lässt man die Quellen bei der Arbeit gar brennen, weil dadurch die
Explosionsgefahr besser im Griff ist - , schwieriger sind die Entfernung der
dicken Schicht von Ölrückständen über und um die Bohrung, die Reparatur
des Bohrlochs und das Anbringen der neuen Quellfassung, besonders wenn das Öl
oder Gas mit grossem Druck an die Oberfläche zischt, wie das im Irak noch häufiger
als in Kuwait der Fall sein soll.
Besondere Probleme stellen sich zudem in jenen Ölfeldern, wo tödliche
Konzentrationen des hochgiftigen Schwefelwasserstoffs entweichen und deshalb
mit Schutzanzügen gearbeitet werden muss. Solche Felder brannten im Süden
Kuwaits, und viele Quellen im Nordosten des Iraks gehören zu dieser
Kategorie. Während man im Frühjahr 1991 noch mit einer Löschzeit von zwei
oder mehr Jahren gerechnet hatte, konnte jedoch bereits im November 1991 die
letzte brennende Ölquelle in Kuwait gelöscht werden. Die Wiederherstellung
der Infrastruktur für die Ölförderung soll laut amerikanischen Angaben über
20 Milliarden Dollar gekostet haben.
Schäden für Gesundheit und Umwelt
Die schlimmsten Auswirkungen, so zeigt sich im Nachhinein, dürften - nicht
zuletzt auch dank günstigen Winden - aber nicht die Brände gezeitigt haben.
Zwar setzten sie riesige Mengen von giftigen Substanzen wie Schwefeldioxid,
Stickoxide, Kohlenwasserstoffe, Metalle und Partikel in die Atmosphäre frei.
Und zeitweise war der Rauch am Boden so dicht, dass "der helle Tag zur
Nacht wurde . . . und die Scheinwerfer die Luft nur drei bis viereinhalb Meter
durchdringen konnten", wie ein Soldat in einer Studie des amerikanischen
Verteidigungsministeriums zu den Auswirkungen des Golfkriegs auf die Veteranen
zitiert wird.
Die zum Teil hohen Schadstoffwerte als Folge der Brände haben laut einer
Studie einer ägyptischen Wissenschafterin in Kuwait zwar zu mehr Arztbesuchen
wegen Irritationen der oberen Atemwege geführt, ein Anstieg akuter
Infektionen der Atemwege oder von Asthma konnte sie dagegen nicht
registrieren. Und ob es zusätzliche Todesfälle als Folge des Rauchs gegeben
hat, liess sich in verschiedenen internationalen Expertisen, so auch in einer
des Grünen Kreuzes von 1998, für die verschiedene Statistiken beigezogen
worden waren, auf Grund mangelnder Vergleichsdaten nicht eruieren.
In einer Arbeit des Pentagons aus dem Jahr 2002, in der im Rahmen von Abklärungen
zum nach wie vor nicht schlüssig geklärten Golfkriegssyndrom die Belastung
der Soldaten durch den Rauch untersucht wurde, stellten die Autoren fest, dass
die Schadstoffwerte in der Luft in der Regel - mit Ausnahme des Feinstaubs -
unter den in den USA für Umgebungsluft oder am Arbeitsplatz geltenden
Grenzwerten gelegen habe. Der für Feinstaub erhobene PM10-Wert dagegen stieg
im Maximum zwar bis über das Siebenfache der in den USA für Umgebungsluft
akzeptierten 150 Mikrogramm pro Kubikmeter - eine Analyse zeigte jedoch, dass
im Durchschnitt etwa drei Viertel des Feinstaubes vom Wüstensand stammte.
Wegen der Wüstenwinde liegt der PM10-Wert in Kuwait denn auch bei normalen
Verhältnissen im Bereich des Vierfachen des amerikanischen
Umgebungsgrenzwertes. Ob die Brände zu einer langfristig erhöhten
Sterblichkeit der Betroffenen führten, wird sich laut verschiedenen
Fachautoren daher erst nach vielen Jahren beurteilen lassen.
Eine grosse Anzahl von Todesopfern war nach einer Auflistung in der
Untersuchung des Grünen Kreuzes dagegen durch die während des ersten
Golfkriegs stark reduzierte medizinische Betreuung der Bevölkerung wegen
fehlenden Personals bedingt. Und eine grosse Gefahr stellten die nicht entschärften
Minen dar.
Eingetrocknete Ölseen
Langfristig grössere Probleme als die brennenden Ölquellen scheinen die Seen
hinterlassen zu haben, die sich durch das Ausfliessen des Öls gebildet
hatten. In der erwähnten Untersuchung des ersten Golfkriegs, die vom Grünen
Kreuz Ende 1998 fertiggestellt wurde, heisst es klipp und klar: Sieben Jahre
nach einer der grössten Ölverschmutzungen in der Geschichte der Menschheit
sei klar, dass der grösste Schaden auf den Böden entstanden sei. Riesige
Gebiete Kuwaits seien verschmutzt. Besonders schlimm sei die Situation in den
Gebieten der Ölseen. Während weniger stark mit Ölablagerungen belastete
Gebiete Zeichen der Erholung zeigten, werde die Situation bei den Seen, bei
denen das Öl immer tiefer in den Boden dringe, ständig schlimmer. 40 Prozent
der ohnehin knappen Trinkwasserreserven Kuwaits seien nicht mehr geniessbar.
Andere unterirdische wasserführende Schichten würden durch den 120 Kilometer
langen Ölgraben gefährdet, den die Iraker entlang der saudischen Grenze
ausgehoben hatten. Heute, gut vier Jahre später, sind nach kuwaitischen
Angaben zwar die meisten Ölseen ausgetrocknet. Der Wind, so wird befürchtet,
könnte die Partikel von eingetrocknetem Ölschlamm jedoch weit verteilen, zu
gesundheitlichen Problemen führen und die Umwelt weiträumig verschmutzen,
besonders da die fragile Oberfläche der Wüste durch die vielen schweren
Fahrzeuge vielerorts ohnehin verletzt ist.
Im Gegensatz zum Land scheint die Meereswelt weniger Schaden genommen zu
haben. Zwar waren sieben Jahre nach dem Einleiten des Öls laut dem Grünen
Kreuz in manchen Bereichen der Küste noch Spuren von Öl zu finden. Aber die
natürlichen Prozesse haben hier zu einer erheblichen Erholung geführt.
Durchschnittlich sei damit zu rechnen, dass 15 Jahre nach einer Ölverschmutzung
das natürliche Gleichgewicht, wenn auch nicht ganz in der ursprünglichen
Art, wieder hergestellt sei. Auch die Korallen im Golf sind offenbar weniger
geschädigt als befürchtet. Für sie scheint die Umweltveränderung nicht grösser
als die üblichen Schwankungen gewesen zu sein.
|
| Neue Zürcher Zeitung, Ressort
Ausland, 25. März 2003, Nr.70, Seite 5 |
| Copyright © Neue Zürcher Zeitung AG |
|




