 |
  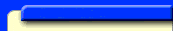
|
 |
 |
Artikel aus Der Standard vom 15. März 2003
|
 |
Saddam Hussein
Aufstieg und Niedergang |
Den Weg des irakischen Diktators vom
erfolgreichen Revolutionär, den der Westen gegen den Iran rüstete, zum
Todfeind der USA verfolgte Erhard Stackl. Der
damals neue starke Mann am Golf nahm den Mund sehr voll. "Wir
werden unsere Revolution bis in die Schlafzimmer der korrupten
Saudi-Prinzen tragen", verkündete Saddam Hussein im Juli 1980 vor
Hunderten aus aller Welt angereisten Journalisten in Bagdad. Am zwölften
Jahrestag der Machtergreifung seiner panarabisch-sozialistischen
Baath-Partei präsentierte sich Saddam, seit kurzem offiziell die Nummer
eins im Irak, als neuer Nasser, als Befreier der Araber und
Herausforderer Israels. "Die Zionisten haben uns immer als rückständige
Kamelreiter hingestellt", dröhnte Saddam, "aber wir werden
Millionen Menschen ausbilden, die technisch alles beherrschen - von der
Produktion einer Nähnadel bis zur Atomkraft."
Der Machtanspruch des damals 43-Jährigen hatte eine reale Basis: Öl.
Von 1970 bis 1980 war der Preis pro Fass (zu 159 Liter) von 2.50 auf 40
Dollar hinaufgeschnellt; 1980 brachten Ölexporte dem Irak 25 Milliarden
Dollar ein. Anders als die feudalistischen Scheichs nutzte Saddam den
Reichtum zu revolutionären Veränderungen: Es gab eine Bodenreform,
Frauen wurden vom Schleier und aus der Abhängigkeit von den Männern
befreit; für eine erfolgreiche Alphabetisierungskampagne erhielt der
Irak den Preis der Unesco. In den Restaurants am Tigrisufer floss der
Alkohol, in Bagdads Kinos lief ein aufwändig produzierter Film über
Saddam Husseins Jugend als panarabischer Revolutionär und Attentäter.
Gegner wurden schon damals erbarmungslos niedergemacht. Amnesty
International berichtete von Hunderten Hinrichtungen - rebellische
Kurden, schiitische Geistliche, Kommunisten und innerparteiliche
Kritiker waren die Opfer. Geschäftsleute aus aller Welt, auch österreichische,
hinderte das freilich nicht, in Bagdad eifrig Aufträge zu keilen.
Fabriken, Spitäler und Brücken wurden gebaut, Nobelhotels von
US-Architekten geplant und von europäischen Firmen hochgezogen.
Frankreich riss sich so sehr um dieses Geschäft, dass der damalige
Premier Chirac daheim schon hämisch "Jacques Irak" genannt
wurde.
Alle lieferten dem säkularen irakischen Regime, dem Todfeind von
Khomeinis islamischer Revolution im Nachbarland Iran, auch Rüstungsgüter;
Frankreich baute - Höhepunkt von Saddams Ambitionen - bei Bagdad den
Forschungsreaktor "Osirak". Israel, für Saddam ein auszulöschendes
"zionistisches Gebilde", sah darin den Griff des Irak nach der
Atombombe. Am 7. Juni 1981 jagten acht israelische F-16-Jets den noch
nicht in Betrieb gegangenen Reaktor in die Luft. (Der jüngste Pilot war
damals übrigens Ilan Ramon, der im Februar 2003 als erster israelischer
Astronaut an Bord des Unglücks-Shuttles Columbia umkam.)
"Als der Irak begann, einen starken Staat aufzubauen, war es die
Idee, ein Gleichgewicht zu Israel zu schaffen", gestand Jahre später
Rahim Alkital, Physiker und damals irakischer Botschafter bei der
Atombehörde in Wien, im Gespräch mit mir ein. Der Irak, der 1971 den
Atomsperrvertrag unterzeichnete, habe angeblich kein militärisches
Forschungsprogramm gehabt. "Wer dem Atomsperrvertrag beitritt,
genießt das volle Recht, ein ziviles Atomprogramm durchzuführen",
sagte Alkital. Doch wozu, wenn nicht zu militärischen Zwecken, sollte
ein in Öl schwimmendes Land wie der Irak ein Nuklearprogramm haben?
Mit Saddam Husseins Machtträumen, die 1982 mit der Abhaltung der
Blockfreien-Konferenz in Bagdad und der Übernahme des Vorsitzes (von
Fidel Castro) in dieser damals politisch bedeutenden Staatengruppe gekrönt
werden sollte, war es schon vorher vorbei. Im September 1980
marschierten die irakischen Streitkräfte, in der Hoffnung auf einen
raschen Sieg, im von Revolutionswirren geschwächten Iran ein. Doch der
erbittert geführte Krieg dauerte bis 1988, etwa eine Million Menschen
kam um.
Zwei Jahre später war ich, auf der anderen Seite der Front, nach
Besichtigung völlig zerstörter iranischer Orte, mit einer
internationalen Journalistengruppe in der grenznahen Stadt Dezful, wo
gerade eine irakische Scud-Rakete eingeschlagen war und mehrere Menschen
getötet hatte. Die aufgebrachte Menge bewarf unseren Kleinbus mit
Steinen und drohte uns Prügel an. Als wir einen Iraner bewegen konnten,
mit uns zu reden, nannte er den Grund des Zorns: "Ihr seid aus dem
Westen, und dieser steckt doch hinter Saddam." Es stimmte: Die
westlichen Staaten, aber auch die Sowjetunion, belieferten, um Geschäfte
zu machen und um den Iran einzudämmen, damals den Irak. Frankreich
verkaufte Kampfjets, Deutschland baute an Raketen, mehrere Staaten
lieferten giftige Chemikalien, die Saddam gegen den Iran und gegen
Kurden einsetzte. (Auch Österreich machte heimlich mit; als aufflog,
dass 200 Noricum-Kanonen auf Umwegen im Irak gelandet waren, gab es
einen Riesenskandal.)
Die USA reichten kriegsentscheidende Satellitenaufnahmen iranischer
Truppenstellungen an den Irak weiter. Donald Rumsfeld, damals schon
einmal US-Verteidigungsminister, reiste 1983 nach Bagdad. In den Jahren
darauf erhöhte die US-Marine ihre Präsenz so stark, dass Teheran 1988
in einen Waffenstillstand einwilligte.
Obwohl der Irak nach dem Krieg mit schweren Zerstörungen und 70
Milliarden Dollar Auslandsschulden dastand, rief sich Saddam zum Sieger
aus. Zur Sicherung seiner geschwächten Macht gab er sich aber zunehmend
muslimisch - und gleich wieder aggressiv: Er verdächtigte Kuwait, auf
das der Irak schon lange Anspruch erhoben hatte, seine Ölfelder
anzubohren, und befahl am 2. August 1990 den Einmarsch.
Als die USA, für Saddam unerwartet, mit Krieg drohten, untersagte er
12.000 westlichen Ausländern die Ausreise. Gerüchteweise hieß es,
dass sie als "menschliche Schutzschilde" an strategisch
wichtigen Punkten festgehalten werden sollten. In dieser dramatischen
Situation flog der damalige österreichische Bundespräsident Kurt
Waldheim Ende August nach Bagdad, um "unsere Geiseln"
heimzuholen.
Nach einem Kurzbesuch bei Saddam, bei dem dieser den US-Truppenaufmarsch
in Saudi-Arabien mit einer "muslimischen Besetzung des
Vatikans" verglich, durfte Waldheim mit rund hundert Österreichern
nach Hause fahren. Während der Präsident dafür daheim gefeiert und im
Ausland als unsolidarisch gescholten wurde, stellte ich gemeinsam mit
zwei weiteren in Bagdad gebliebenen Journalisten überrascht fest, dass
einige Firmenvertreter, auch Österreicher, freiwillig im Irak geblieben
waren. Manche "Geiseln" litten aber, bis sie alle ausreisen
durften, tatsächlich große Angst.
Im November 1990 gab der UN-Sicherheitsrat nach einem diplomatischen
Gerangel, das dem gegenwärtigen glich, der von den USA geführten
Koalition die Vollmacht, nach Ablauf eines Ultimatums die Sicherheit in
der Golfregion "mit allen erforderlichen Mitteln"
wiederherzustellen. Als ab dem 16. Jänner Bomben auf Bagdad fielen, war
ich in Israel und zitterte mit den Menschen mit, die in Bunkern hockten
und nicht wussten, ob die von Saddam abgefeuerten Scud-Raketen chemische
Sprengköpfe trugen. Spätestens damals wurde klar, warum sie Saddam für
immer weghaben wollten.
Im Mai 1991, kurz nach Kriegsende, fuhr ich durch den zerstörten Irak.
In Bagdad hatten die Bomben großteils ihre Ziele erreicht. Eine
Familie, die neben einem zerbombten Regierungsgebäude wohnte, erzählte
mir, wie sie im Keller überlebt hatte. Die Bomben trafen aber auch
E-Werke, elektrische Wasserpumpstationen wurden lahm gelegt. Mangel an
Wasser und Nahrung brachte Krankheiten und bedeutete, wie
Hilfsorganisationen erhoben, für Zehntausende Kinder den Tod. Erst ab
1996, als der Irak dem UNO-Plan zustimmte, Öl für Nahrungsmittel zu
exportieren, ging die Kindersterblichkeit zurück.
|
|
| DER
STANDARD, Printausgabe, 15./16.3.2003 |
|
|




